EZB: Das Rennen um Lagardes Nachfolge ist eröffnet. Wird es ein Deutscher?
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Den Auftakt macht der Posten des Vizepräsidenten Luis de Guindos, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Im Jahr 2027 laufen dann die Amtszeiten von Präsidentin Christine Lagarde, Chefökonom Philip Lane und Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel aus. Unter den Hauptstädten der Eurozone beginnt der Kampf um die einflussreichsten geldpolitischen Ämter des Währungsraums.
Ein komplexes Machtgefüge
Das Stühlerücken in Frankfurt beginnt mit der Nachfolge von de Guindos. Berichten der FT zufolge steht die EZB kurz davor, Brüssel formell um den Start des Nachfolgeprozesses zu bitten. Die Finanzminister der Eurozone könnten bereits diese Woche erste Gespräche aufnehmen. Die Neubesetzung des Vizepräsidenten-Postens ist von hoher strategischer Bedeutung, da Nationalität und geldpolitische Ausrichtung des Kandidaten das Ringen um die Lagarde-Nachfolge maßgeblich beeinflussen werden.
"Die gesamte Bandbreite der europäischen Mitgliedsstaaten im EZB-Direktorium abzubilden, ist eine hochkomplexe Aufgabe", so Jens Eisenschmidt, Chefvolkswirt für Europa bei Morgan Stanley. Es gilt die ungeschriebene Regel, dass kein Land zwei Sitze im Direktorium halten darf.
Zudem wird stets ein Gleichgewicht zwischen "Falken" (Befürwortern einer straffen Geldpolitik) und "Tauben" (Befürwortern einer lockeren Geldpolitik) angestrebt. Erschwerend kommt hinzu, dass die osteuropäischen und baltischen Staaten, die seit 2007 beigetreten sind, nun ebenfalls vehement einen Sitz im Top-Gremium fordern.
Für die De-Guindos-Nachfolge haben sich bereits Kandidaten in Stellung gebracht. Finnland schickt seinen Notenbankgouverneur Olli Rehn ins Rennen, der als "Taube" gilt. Kroatien wird voraussichtlich seinen Zentralbankchef Boris Vujčić nominieren.
Knot, Nagel und de Cos: Die Favoriten für die Spitze
Das Ringen um den prestigeträchtigsten Job – die Präsidentschaft – hat hinter den Kulissen längst begonnen. Als Hauptanwärter auf die Nachfolge von Christine Lagarde gelten derzeit zwei Männer: der niederländische Zentralbankgouverneur Klaas Knot und Bundesbankpräsident Joachim Nagel.
Knot, ein erfahrener Ökonom mit Stationen beim IWF und der niederländischen Zentralbank, genießt hohes Ansehen. Selbst Lagarde lobte ihn kürzlich in einem Podcast: "Er hat den Intellekt, die Ausdauer [und] er ist fähig, Menschen einzubeziehen, und das ist eine Fähigkeit, die selten und sehr notwendig ist". Sie fügte hinzu, Knot sei jedoch "nicht der einzige" mit dieser Fähigkeit. Knots frühere, eher falkenhafte Haltung könnte ihm jedoch den Widerstand aus südlichen Mitgliedsstaaten einbringen.
Joachim Nagel wiederum wirbt in Berlin aktiv um Unterstützung für seine Kandidatur an die EZB-Spitze. Deutschland stellte, trotz seiner überragenden wirtschaftlichen Bedeutung, noch nie den EZB-Präsidenten. Es wäre natürlich an der Zeit, aber auch kompliziert, einen Deutschen an die Spitze zu bringen.
Als dritter aussichtsreicher Kandidat wird Pablo Hernández de Cos gehandelt. Der Spanier, derzeit Generalmanager der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), würde laut Insidern "alle Kriterien erfüllen". Er gilt als pragmatischer Ökonom und respektierte Stimme. Zudem hatte Spanien, wie Deutschland, noch nie die Präsidentschaft inne und wäre nach dem Abgang von de Guindos nicht mehr im Direktorium vertreten.
Die Hürden: Geschlecht, Politik und deutsche Dominanz
Die Besetzung der Spitzenposten ist mehr als eine Frage der fachlichen Qualifikation. Auch die Geschlechterbalance spielt in der heutigen Zeit eine zentrale Rolle. Das EZB-Direktorium war historisch stark männlich dominiert; seit 1998 waren nur 19 % der Mitglieder Frauen. Besonders Frankreich und das Europäische Parlament dürften auf die Ernennung von Frauen dringen. Als starke Kandidatinnen für einen Sitz im Direktorium gelten unter anderem die stellvertretende französische Zentralbankgouverneurin Agnès Bénassy-Quéré und ihre griechische Amtskollegin Christina Papaconstantinou.
Joachim Nagel stellt sich ein besonderes Hindernis in den Weg: die aktuelle deutsche Dominanz in den EU-Institutionen. Mit Ursula von der Leyen an der Spitze der Kommission, Claudia Buch bei der Bankenaufsicht (SSM) und Verena Ross bei der Wertpapieraufsicht (ESMA) halten Deutsche bereits Schlüsselpositionen. Die Bereitschaft in Berlin, für den SPD-Mann Nagel zu kämpfen, wird zudem intern infrage gestellt. "Ich habe keinen Hinweis, dass sich das mit [Kanzler Friedrich] Merz geändert hat", zitierte die Financial Times einen Berliner Regierungsbeamten, der sich fragte, warum "ein konservativer Kanzler für einen Sozialdemokraten kämpfen sollte". Und über alldem thront zudem eines: Ein Deutscher wird immer auch als "Falke" gesehen. Die meisten Staaten der Eurozone würden aber gerne eine eher lockere Geldpolitik sehen.
Fazit
Als Börsianer und Bürger ist man zwiegespalten. Für die Börsen ist eine lockere Geldpolitik zweifellos ein wichtiger Antriebsfaktor. Aber natürlich will man auch stabiles Geld.
Ob die Eurozone vor einem deutschen EZB-Chef noch große Angst haben muss, ist fraglich. So wie Deutschland inzwischen dasteht und angesichts der massiven Verschuldungswelle der kommenden Jahre wird auch die Politik hierzulande nicht mehr so stark gegen eine laxe EZB-Politik opponieren, wie das noch zu Zeiten Draghis der Fall war. Und Nagel ist nicht annähernd so ein Falke, wie es damals Jens Weidmann war, der ebenfalls Ambitionen auf den Vorsitz hatte. So wie sich die Dinge derzeit entwickeln, wird es wohl irgendwann in den nächsten Jahren wieder in Richtung Niedrigzinsen und sogar Quantitative Easing (QE) gehen. Allerdings muss dazu eine ganz entscheidende Voraussetzung erfüllt sein: Die Inflationsraten müssen noch weiter runter.
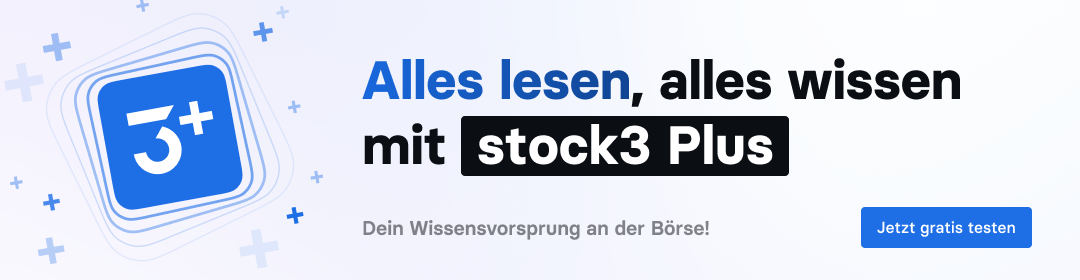


Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.